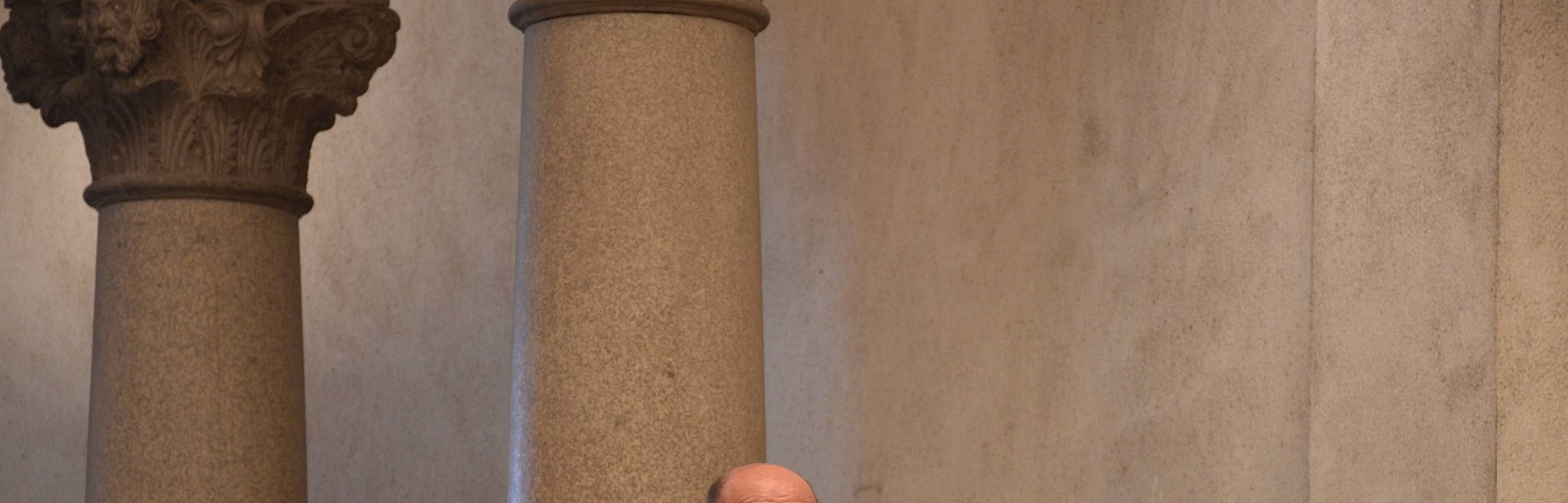FRANKFURT, 01.09.2019
Dass es gut werden kann
80 Jahre nach dem Beginn des Zweiten Weltkriegs durch den Überfall Deutschlands auf Polen hat der katholische Stadtdekan Johannes zu Eltz am Sonntag, 1. September, dem Antkriegstag, an den „Kniefall von Warschau“ des damaligen Bundeskanzlers Willy Brandt erinnert. Diese „große Geste, eine große Stunde für Deutschland“ habe der Welt gezeigt, dass es trotz unendlichen Leids und Unrechts „mit uns weitergehen kann; dass es mit uns noch einmal gut werden kann,“ betonte der Stadtdekan.
Gemäß dem Wort aus dem Lukas-Evangelium „Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden“ (Lk 14, 11), habe der unerwartete Kniefall Brandts 1970, so der Stadtdekan, „die ungenötigte, freiwillige Erniedrigung seiner selbst aus dem Eindruck einer unerträglichen Schuld, einer nicht einfach zu schulternden Verantwortung“ gezeigt. Das habe „mehr vorangebracht, mehr erreicht, vor allem: mehr Hoffnung gestiftet, mehr Vertrauen erzeugt als viele Worte“. Ein deutscher Bundeskanzler, und damit Deutschland, „nicht zerschmettert am Boden, sondern willentlich ohne ein Wort auf den Knien“, das habe es für die, denen die „Angst vor uns, die Abscheu vor uns in den Knochen steckte, vorstellbar gemacht“, dass eine Wended zum Besseren trotz allem möglich ist.
Damit habe Willy Brandt, der wohl kein religiöser Mensch gewesen sei, das Evangelium wahr gemacht: wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. „Und nicht nur, nicht zuerst er selber wird erhöht werden, sondern die, für die er ging – sein Volk –, und das, wofür er stand: sein Land.“
Deutschland, nicht zerschmettert am Boden, sondern willentlich ohne ein Wort auf den Knien – das hat es für die, denen die Angst vor uns, die Abscheu vor uns in den Knochen steckte, vorstellbar gemacht, dass es trotz allem mit uns weitergehen kann; dass es mit uns noch einmal gut werden kann.
Die Deutschen sollten ihr Land offen halten
Nicht die Deutschen sollten Deutschland über alles stellen, „weil wir sonst Angst und Schrecken verbreiten“, hob zu Eltz hervor, sondern die Deutschen sollten „ihr Land offen halten, gerecht, lebenswert, liebenswert, und schön“. Dann würden diejenigen Deutschland und die Deutschen „erheben“, denen eine Chance gelassen werde, das in Freiheit und Wahrheit selber zu tun: „Das ist ein Grundgesetz der Liebe und des Vertrauens, solange Stärke und Schwäche, Hoffnung und Furcht nur ein labiles Gleichgewicht erreichen können. `Deutschland, Deutschland über alles` sollen, dürfen, brauchen nicht wir zu singen; das sollen Polen singen, wenn sie uns denn wirklich gute Nachbarn finden; Japaner, die Bach und Hölderlin mehr lieben als wir; Franzosen, die mit uns an der Deichsel des europäischen Karrens ziehen; Syrer, Eritreer, Leute aus dem subsaharischen Afrika, denen hier oder von hier aus wirklich uneigennützig geholfen wird.“ Nur dann könnten diese Menschen wie Desmond Tutu, der anglikanische Alterzbischof von Kapstadt, sagen: „Als ich das gesehen habe“ – er meinte die halsbrecherische Humanität der Deutschen im Herbst 2015 – „als ich das gesehen habe, war ich stolz darauf, ein Mensch zu sein.“
Predigt zum 1. September 2019, 80 Jahre nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs
„Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden“ (Lk 14, 11).
Liebe Gemeinde, wenn Sie das Wort „Kniefall“ in die Suchmaschine geben, kommt sofort an erster Stelle mit Bild der „Kniefall von Warschau“ vom 7. Dezember 1970, Unterschrift: Versöhnungsgeste von Willy Brandt. Unmittelbar vor der Unterzeichnung des „Warschauer Vertrages“ legte der Bundeskanzler wie für Staatsgäste üblich einen Kranz vor dem Ehrenmal der Helden des Ghettos nieder, richtete wie üblich die Kranzschleifen, verharrte wie üblich einen Moment im Stehen, und dann beugte er – wie überhaupt nicht üblich – die Knie auf den nackten Asphalt, und kniete dort eine halbe Minute, eine halbe Ewigkeit lang. Das war nicht vorgesehen, das wusste niemand, das hatte Willy Brandt sich auch nicht von langer Hand ausgedacht. Die Umgebung erstarrte, nur die Auslöser der Kameras klickten wie verrückt. Das Schwarzweiß-Bild vom Kanzler auf den Knien ging um die Welt, und es hat einen festen Platz in der Ikonographie des 20. Jahrhunderts. Wer das Bild gesehen hat, vergisst es nicht.
Einhelligen Beifall fand die Versöhnungsgeste keineswegs; die Auseinandersetzung um die Person und Kanzlerschaft von Willy Brandt und um die „Ostverträge“ war so grundsätzlich, so leidenschaftlich und stellenweise so voller Hass wie nur irgendeine Auseinandersetzung heute. Einer SPIEGEL-Umfrage zufolge fanden damals 48 % der Westdeutschen den Kniefall übertrieben, 41 % angemessen. 11 % hatten keine Meinung dazu. In der DDR wurde das Ereignis totgeschwiegen.
Ich war damals 13 und hatte die konservativen Positionen meines Vaters und meiner Verwandtschaft verinnerlicht. Der CSU-Abgeordnete Karl Theodor zu Guttenberg hielt im Bundestag eine große Grundsatzrede gegen die Ostpolitik und die „Ostverträge“ der Regierung Brandt. Ich fand das richtig. Ich hätte zu den 48 % gehalten, die den Kniefall unangemessen fanden. Aber das hat sich später geändert. Der „Kniefall von Warschau“ war eine große Geste, eine große Stunde für Deutschland. Die ungenötigte, freiwillige Erniedrigung seiner selbst aus dem Eindruck einer unerträglichen Schuld, einer nicht einfach zu schulternden Verantwortung hat mehr vorangebracht, mehr erreicht, vor allem: mehr Hoffnung gestiftet, mehr Vertrauen erzeugt als viele Worte. Der kommunistische Ministerpräsident Jozef Cyrankiewicz, der den Warschauer Vertrag auf der polnischen Seite unterzeichnete, wurde 1941 von den Deutschen verhaftet und war bis zum Schluss, bis zum 27. Januar 1945, im KZ Auschwitz. Überlebende haben oft erzählt, dass es die Stimme der SS-Leute war, die sie bis in die Albträume verfolgt hat; die herrische Stimme und die Worte aus dem „Wörterbuch des Unmenschen“.
Ein deutscher Bundeskanzler, und damit Deutschland, nicht zerschmettert am Boden, sondern willentlich ohne ein Wort auf den Knien – das hat es für die, denen die Angst vor uns, die Abscheu vor uns in den Knochen steckte, vorstellbar gemacht, dass es trotz allem mit uns weitergehen kann; dass es mit uns noch einmal gut werden kann. Bundespräsident Walter Steinmeier, der heute früh in Wielun, der von der Wehrmacht zuerst angegriffenen Stadt in Polen, des Kriegsbeginns vor 80 Jahren gedachte, hat auf diesem Fundament weitergebaut. Er sagte: „Ich verneige mich vor den Opfern des Überfalls auf Wielun. Ich verneige mich vor den Opfern der deutschen Gewaltherrschaft. Und ich bitte um Vergebung.“ Erst auf Deutsch, dann auf Polnisch. Und nicht um Entschuldigung hat er gebeten, den das unermessliche Unheil, das Nazi-Deutschland über die Welt gebracht hat, ist nicht zu entschuldigen. Aber vergeben, verzeihen können die Nachfahren der Opfer denen, die als Nachfahren der Täter, der Mitläufer, der Wegschauer persönlich Verantwortung übernehmen, auch wo sie persönlich keine Schuld tragen. Der Bundespräsident hat sich verneigt, nicht hingekniet; das musste er nicht. Das hat Willy Brandt gemacht. Der hat den Boden berührt und den Boden bereitet. Ein religiöser Mensch war Willy Brandt, soviel ich weiß, nicht, aber er hat das Evangelium wahr gemacht: wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Und nicht nur, nicht zuerst er selber wird erhöht werden, sondern die, für die er ging – sein Volk –, und das, wofür er stand: sein Land.
Das ist am Ende auch nicht schwer zu verstehen, dass nicht die Deutschen Deutschland über alles stellen sollen, weil wir sonst Angst und Schrecken verbreiten, sondern dass wir unser Land offen halten sollen, gerecht, lebenswert, liebenswert, und schön. Dann werden es andere tun. Dann werden uns die „erheben“, denen wir eine Chance lassen, das in Freiheit und Wahrheit selber zu tun. Denn so sind wir geschaffen. Das ist ein Grundgesetz der Liebe und des Vertrauens, solange Stärke und Schwäche, Hoffnung und Furcht nur ein labiles Gleichgewicht erreichen können. Hienieden können Amerikaner Amerika nicht wieder groß machen, das müssen sie den Freunden und Bewunderern Amerikas überlassen. Und „Deutschland, Deutschland über alles“ sollen, dürfen, brauchen nicht wir zu singen; das sollen Polen singen, wenn sie uns denn wirklich gute Nachbarn finden; Japaner, die Bach und Hölderlin mehr lieben als wir; Franzosen, die mit uns an der Deichsel des europäischen Karrens ziehen; Syrer, Eritreer, Leute aus dem subsaharischen Afrika, denen hier oder von hier aus wirklich uneigennützig geholfen wird, und die dann wie Desmond Tutu, der anglikanische Alterzbischof von Kapstadt, sagen können: „Als ich das gesehen habe“ – er meinte die halsbrecherische Humanität der Deutschen im Herbst 2015 – „als ich das gesehen habe, war ich stolz darauf, ein Mensch zu sein.“
Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Amen
Johannes zu Eltz, Stadtdekan